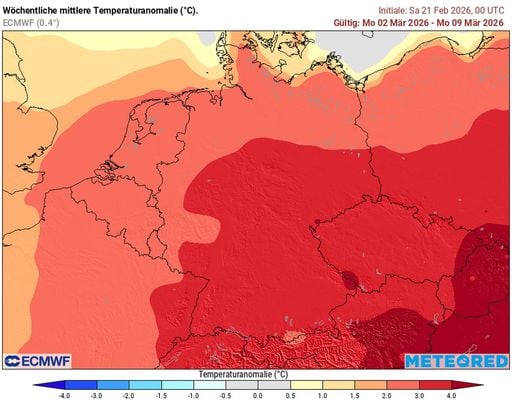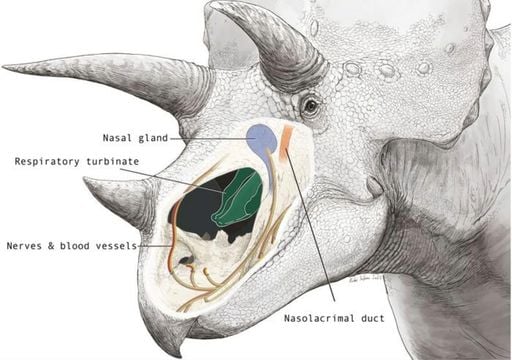Fallen die letzten Grenzen? Zur Ausbeutung der Tiefsee
Zahlreiche Metalle und seltene Erden lagern in der Tiefsee am Meeresboden. Diese werden immer wertvoller. Der Abbau dieser Ressourcen könnte aber ein sensibles Gleichgewicht für sehr lange Zeit zerstören – und riesige Mengen an CO₂ freisetzen.

Ende der 1980er-Jahre pflügte ein Forschungsteam in 4000 m Meerestiefe vor der Küste Perus eine Schneise in den Tiefseeboden.
Die Absicht dahinter war allerdings nicht eine Auslotung der Optionen zur Ausbeutung der möglicherweise in den Tiefseeschichten enthaltenen Rohstoffe, sondern die Beobachtung der Regenerationsfähigkeit der Tiefsee nach einem solchen Eingriff.
Nur sehr langsame Regeneration
Die Forschenden wollten mit ihrer Maßnahme beobachten, wie sich der Meeresgrund nach einem solchen oberflächlichen Eingriff erholt. Die Ergebnisse sind ernüchternd und alarmierend, denn die zeigen, dass eine Erholung, wenn überhaupt, nur sehr langsam von statten geht.
Noch heute sind die Spuren der Tiefseeschneise immer noch deutlich sichtbar. Das Sediment hat sich über Jahrzehnte weder regeneriert noch entscheidend bewegt. Viele der Organismen, die einst hier lebten, sind bis heute verschwunden.
US-Pläne geben neuen Anstoß der Debatte
Immer wieder wurden Pläne zum Abbau von Rohstoffen in der Tiefsee vorgelegt. Die seit Januar eingesetzte US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat die feste Absicht, dem Thema eine völlig neue Dynamik zu verpassen.
Allerdings nimmt damit auch die Debatte über den Schutz des Meeresbodens wieder an Fahrt auf.
So erklärte Erik Simon-Lledo, Hauptautor einer Studie, welche die Ergebnisse aus Peru auswertete, dazu
Hintergrund dieser Aussage ist die Tatsache, dass der tiefe Meeresboden bisher wenig erforscht ist. Die Studie aus Peru dokumentiert lediglich die Folgen des Aussterbens von Arten. Hinzu käme nach Aussage der Forschenden die Freisetzung massiver CO₂-Mengen, die im Sediment gespeichert liegen. Eine genaue Spezifikation ist allerdings nicht möglich, d.h. das Ausmaß kann bis heute bestenfalls nur geschätzt werden.
Tiefsee als neuer Wilder Westen
Wenig überraschend stehen auf der anderen Seite der Debatte zum Pro und Kontra des Tiefseebergbaus knallharte wirtschaftliche Interessen. Ein Beispiel dafür sind die Manganknollen, die in großer Menge in der sogenannten Clarion-Clipperton-Zone zwischen Hawaii und Mexiko vorkommen. Neben Mangan enthalten die kartoffelgroßen Knollen auch Kupfer, Nickel und Kobalt. Diese Metalle haben in der Energiewende stark an Wert gewonnen.
Schon lange planen Unternehmen die Knollen an die Oberfläche zu holen. Und noch nie war die Genehmigung für das Vorhaben wahrscheinlicher. Donald Trump wies die zuständigen Behörden bereits an, den eingereichten Projekten sehr viel schneller grünes Licht zu geben. Dabei liegen die begehrten Rohstoffe nicht in US-amerikanischen, sondern in internationalen Gewässern.
Vehemente Opposition
Derartiger Pläne bezeichnete der französische Präsident Emmanuel Macron bei der UN-Ozeankonferenz in Nizza als »Wahnsinn« und »…gefährlich zerstörerisch«. Er betonte, dass die Ozeane nicht zum Verkauf stünden. Der UN-Generalsekretär António Guterres fügte hinzu
Die Vorhaben für den Tiefseebergbau sorgten bei der Konferenz insgesamt für viel Kritik. Eine Gruppe von 37 Staaten forderte schließlich offiziell ein Moratorium für den Tiefseebergbau, also ein Ende der Pläne zur wirtschaftlichen Ausbeutung der Metalle am Meeresgrund. In Anbetracht des bisherigen Verhaltensmusters der amerikanischen Regierung ist es allerdings zweifelhaft, ob derartige Forderungen in Washington überhaupt Gehör und Beachtung finden.
Bestehende Regeln zur wirtschaftlichen Ausbeutung der Tiefsee
Seit Jahrzehnten bestehen sowohl feste Regeln für die Erforschung und die mögliche wirtschaftliche Ausbeutung der Tiefsee. Die Aufsicht liegt bei der Internationalen Meeresbodenbehörde (ISA) mit Sitz in Jamaika. Sie ist für alle Aktivitäten in den Tiefen zuständig, die zu keinem Staat gehören.
In einem multilateralen Rahmen, dem UN-Seerechtsübereinkommen, haben sich 170 UN-Staaten darauf geeinigt, dass kein Staat Besitzansprüche auf dort liegende Rohstoffe stellen kann.
Entsprechend empört reagierte ISA-Vorsitzende Leticia Reis de Carvalho auf Trumps Dekret:
Wenig überraschend sind damit die USA gemeint, die das Abkommen bis heute nicht unterzeichnet haben.
Zahlreiche Wissenslücken
Die von den USA nun vorangetriebene Ausbeutung durch Einsammeln von Manganknollen hat auf die Tiefsee-Biosphäre gravierende Auswirkungen. Die Knollen sind für kleine Korallen, Schwämme und andere Tiefseebewohner, die an ihnen Halt finden, deren essenzieller Lebensraum. Ferner entdeckten Forschende im vergangenen Jahr in der Clarion-Clipperton-Zone einen unerwarteten Prozess: Manganknollen produzierten Sauerstoff.
Sabine Gollner ist Tiefseebiologin am Royal Netherlands Institute for Sea Research, Sie sagte dazu
Eine weitere große Unbekannte seien die Sedimente, die beim Abbau aufgewirbelt werden. Wenn man nur ein bis zwei Zentimeter Sediment vom Boden löse, zerstöre man dabei Prozesse, die mehrere Tausend Jahre alt sind, so Gollner.
Eindeutig sei lediglich, dass eine Entfernung der Knollen nicht dazu führt, dass sich diese wieder „erholen“. Manganknollen wachsen in einer Million Jahre nur wenige Millimeter. Damit wüsste man, für wie lange wir die Knollen verlieren. Es bliebe aber unbekannt, was genau wir da eigentlich verlieren, so die Biologin.
Die Frage aller Fragen
Auch Jens Greinert vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel beschäftigt sich mit den Konsequenzen des Tiefsee-Bergbaus. Für ihn steht außer Zweifel, dass der Mensch mit den Bergbauprojekten die Tiefsee massiv verändern wird.
Boden und Meer stünden im ständigen Austausch. Der Boden nimmt Nährstoffe auf, gibt sie wieder ab und ist für verschiedene chemische Prozesse im Meer entscheidend. Hier habe sich, so Greinert, seit Jahrmillionen ein Gleichgewicht hergestellt. Dessen empfindliche Balance käme durch den Tiefseebergbau durcheinander.