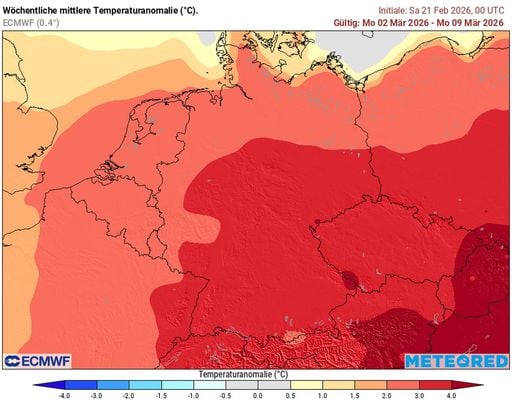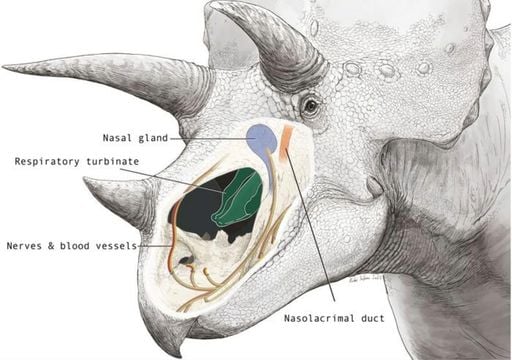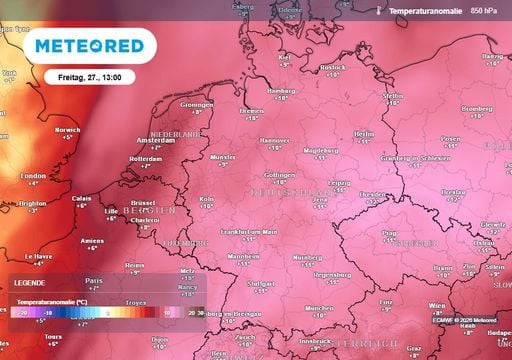Grün statt Beton: Wie Kö-Bogen II Düsseldorfs Innenstadt vor dem Hitzetod rettet
Städtischer Hitzstress und Überhitzung drohen in vielen Städten zu unlösbaren Problemen zu werden. Doch das Kö-Bogen II in Düsseldorf zeigt, wie grüne Architektur die Innenstadt vor der Sommerglut retten kann.

Das €600 Millionen teure, gemischt genutzte Bauprojekt umfasst 24.000 Quadratmeter Verkaufsfläche, 5.500 Quadratmeter Bürofläche und eine Tiefgarage mit 450 Stellplätzen.
Im Zentrum des Projekts steht jedoch ein innovatives Konzept für grüne Fassaden, das eine visionäre Antwort auf städtische Hitzinseln, Biodiversität und die Verbesserung des Mikroklimas in Städten bietet.
Eine Grüne Revolution in der Architektur
Die begrünte Gebäudehülle des Kö-Bogen II ist ein Paradebeispiel dafür, wie Architektur mit der Umwelt im Einklang stehen kann. Das Team von Christoph Ingenhoven entschied sich für die heimische Hainbuche (Carpinus betulus) aufgrund ihrer Robustheit, Anpassungsfähigkeit und ihrer ökologischen Vorteile.
Die Hainbuchenhecken, die sich über 8 Kilometer erstrecken, bieten nicht nur einen visuell beeindruckenden Aspekt, sondern auch bedeutende ökologische Vorteile.
Sie mildern den städtischen Wärmeinseleffekt, indem sie die Gebäudefassade im Sommer beschatten und eine übermäßige Wärmeaufnahme verhindern.
Kö-Bogen II Office Building / ingenhoven architects https://t.co/S2MPMckQuz
— ArchDaily (@ArchDaily) August 2, 2021
Die Begrünung verhindert, dass sich die Fassade des „Kö-Bogen 2“ bei starker Sonneneinstrahlung überproportional auf bis zu 70 Grad aufheizt und diese Wärme in die Umgebungsluft zurückgeht.
Die Pflanzen binden CO2, reduzieren Feinstaub, produzieren Sauerstoff und bieten Lebensraum für eine Vielzahl von Insekten und Vögeln.
Integrierte Technologie für Nachhaltigkeit
Hinter der grünen Fassade verbirgt sich eine ausgeklügelte technologische Infrastruktur, die sicherstellt, dass die Pflanzen gesund bleiben und das Gebäude energieeffizient bleibt:
- Ein duales Bewässerungssystem sorgt für die notwendige Wasserversorgung der mehr als 30.000 Pflanzen auf dem Gebäude. Dabei wird eine Mischung aus Stadtwasser und Osmosewasser verwendet, um den idealen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
- Das System wird durch eine Reihe von Sensoren und einen zentralen Computer unterstützt, der die Wassermenge und Nährstoffzufuhr kontinuierlich überwacht und anpasst.
- Zwei unabhängige Bewässerungssysteme bieten eine Redundanz, um Ausfälle der Technik zu vermeiden.
- Um zu verhindern, dass die Leitungen im Winter einfrieren, enthält das System Kompressoren, die bei fallenden Temperaturen automatisch Wasser aus den frostgefährdeten Leitungen blasen. So wird sichergestellt, dass die Pflanzen auch in der kalten Jahreszeit weiterhin mit Wasser versorgt werden, ohne dass die Infrastruktur beschädigt wird.
Wissenschaftlich fundierte Planung
Die Auswahl der Hainbuche als bevorzugte Pflanzenart wurde durch wissenschaftliche Untersuchungen am Institut für Phytotechnologie an der Beuth Hochschule für angewandte Wissenschaften in Berlin unterstützt.
Der Phytotechnologe Karl-Heinz Strauch und sein Team führten Tests durch, um herauszufinden, wie verschiedene Pflanzenarten das Mikroklima beeinflussen.
Im Gegensatz zu immergrünen Pflanzen verliert die Hainbuche im Winter ihre Blätter und reduziert so ihren Wasserverbrauch.
This is the largest #green facade in Europe: it covers a building called Kö-Bogen II in the heart of #Düsseldorf, Germany #Sustainability #NetZero #AirPollution #Architecture @Hana_ElSayyed @CurieuxExplorer @Shi4Tech @mvollmer1 @drsharwood @enilev @Khulood_Almani @kalydeoo pic.twitter.com/VVOcE3ktB7
— Franco Ronconi (@FrRonconi) October 20, 2023
Wartung und Innovation
Trotz der sorgfältigen Planung und technischen Investition ist die Pflege einer grünen Fassade eine kontinuierliche Herausforderung. Vertikale Gärten, obwohl optisch beeindruckend, erfordern oft einen hohen Wartungsaufwand, um Probleme wie welkende Pflanzen, Überbelichtung oder Frostschäden zu vermeiden.
Das Kö-Bogen II-Projekt geht diesen Herausforderungen mit einem maßgeschneiderten Wartungsplan nach. Laufstege und Fassadenbefahranlagen ermöglichen den einfachen Zugang zu den Hecken, während speziell angefertigte Maschinen, wie ein Häcksler für das Schnittgut, eine effiziente Pflege gewährleisten.
Die Hecken entlang der Schadowstraße bieten einen auffälligen visuellen Kontrast zur umgebenden urbanen Architektur und schaffen gleichzeitig einen grüneren, lebenswerteren Stadtraum.
Innovative Grüne Fassadentechnologie am Kö-Bogen II: Ein Modell für urbane Klimalösungen
Das Kö-Bogen II in Düsseldorf ist mehr als nur ein modernes Bauwerk – es ist ein visionäres Symbol für die Zukunft der Stadtgestaltung. Christoph Ingenhoven, der Architekt hinter diesem bahnbrechenden Projekt, spricht von einem Paradigmenwechsel: dem Übergang vom automobilen Zeitalter hin zu einer Stadtplanung, die den Menschen und das Klima in den Mittelpunkt stellt.
Mehr Infos:
UBM Development. (n.d.). Düsseldorfs neue grüne Mitte: Kö-Bogen II. Abgerufen am 12. Februar 2025, von https://www.ubm-development.com/magazin/gruen-gruener-koe-bogen-2/